Wie funktioniert das Internet wirklich?
Eine technische Tiefenbohrung ins Herz des Netzes
Ihr Guide für heute
Jan-Philipp Warmers
Operativer Betrieb Core (MPLS)
Hinter jedem Klick...
...verbirgt sich ein komplexes Ökosystem aus Protokollen und Hardware.
Heute entschlüsseln wir die Magie.
Das ist Klaus
Er will wissen, wie seine Lieblingsfilme eigentlich zu seinem TV kommen.
Klaus weiß, dass sein Fernseher mit WLAN an seinem Router angeschlossen ist
Aber wie geht's weiter von hier?
Klaus fragt sich, wie sein Fernseher die Daten aus dem Internet bekommt.
Hausanschluss
Klaus hat beim Aufbau der Glasfasertechnik sich die Baustelle angeguckt und gesehen, dass sie einen Schrank am Ende der Straße aufgebaut haben.

Verantwortung Access Teams
 Access-Teams: Anbindung der Haushalte
Access-Teams: Anbindung der Haushalte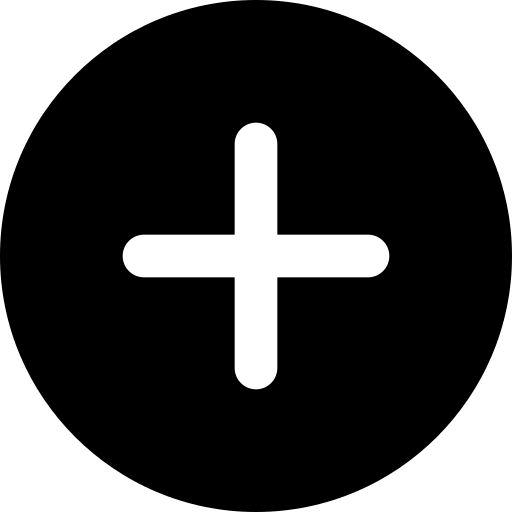 Aufgaben: Installation, Wartung, Fehlerbehebung
Aufgaben: Installation, Wartung, Fehlerbehebung Technologien: FTTH, FTTB, DSL
Technologien: FTTH, FTTB, DSL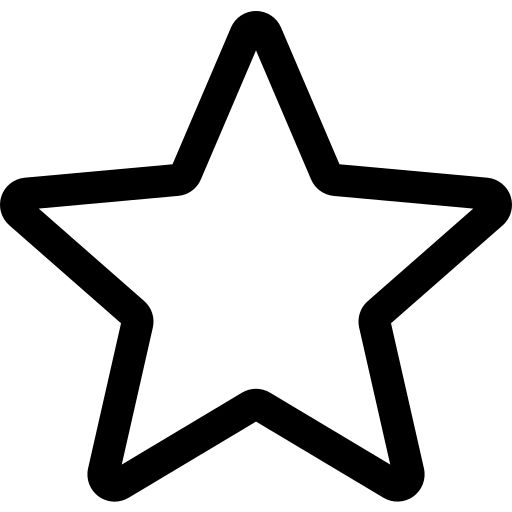 Zugangsebene: Entscheidend für Qualität der Verbindung
Zugangsebene: Entscheidend für Qualität der Verbindung
Vom Hausanschluss ins große Netz
Nach dem MFG (Multifunktionsgehäuse) geht die Reise für Klaus' Daten weiter. Die vielen einzelnen Glasfaseranschlüsse aus den Häusern werden gebündelt.
Anschluss Geschwindigkeiten in dieser Ebene sind oft 10, 25 oder 100 Gbit/s. Bei DSL-Anschlüssen sind es oft noch 1 Gbit/s.
Die Technik im Haus: Vom Licht zum Datenpaket
Bei Klaus zuhause passiert die eigentliche Magie. Das Lichtsignal aus der Glasfaser muss in ein für den Computer verständliches Signal umgewandelt werden.
ONT: Der Glasfaser-Übersetzer
Der ONT (Optical Network Terminal) oder auch Glasfasermodem genannt, ist das erste Gerät im Haus. Seine einzige Aufgabe: Das optische Signal der Glasfaser in ein elektrisches Ethernet-Signal umzuwandeln.
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
graph LR
A[Glasfaser] -- Lichtsignal --> B(ONT);
B -- Elektrisches Signal --> C[Router];
xPON: Geteilte Freude, volle Geschwindigkeit
Moderne Glasfaseranschlüsse nutzen oft Passive Optical Network (PON). "Passiv" bedeutet, dass zwischen Vermittlungsstelle und Kunde keine aktive Technik nötig ist. Ein optischer Splitter teilt das Signal auf mehrere Haushalte.
Das ist kosteneffizient, bedeutet aber, dass sich Haushalte die Bandbreite teilen. Dank der hohen Kapazität von Glasfaser merkt Klaus davon in der Regel nichts.
Router: Die Zentrale im Heimnetz
Der Router erhält das Signal vom ONT. Seine Aufgaben sind:
- Netzwerk aufbauen: Er stellt das WLAN und die LAN-Anschlüsse für alle Geräte von Klaus bereit.
- Verbindung herstellen: Er baut die Verbindung zum Internet-Provider auf (z.B. via PPPoE).
- Adressen verwalten: Er vergibt lokale IP-Adressen an Fernseher, Laptop & Co. (NAT).
TR-069: Die Fernwartung des Providers
Schon mal gewundert, wie der Provider bei Problemen "auf den Router schauen" oder ein Update einspielen kann? Das geschieht oft über das Technical Report 069 (TR-069) Protokoll.
Es erlaubt dem Provider, den Router von Klaus aus der Ferne zu konfigurieren, zu diagnostizieren und zu aktualisieren, ohne dass ein Techniker vorbeikommen muss.
Aggregation / Metro-Netz

Netzwerk Container verbinden Oft mehrere Städte und Dörfer. Dort wird der Datenverkehr auf Strecken geschickt, die 40+km lang sind.
Die Rolle von MPLS
Im Metro-Netz wird der Verkehr meist mit MPLS (Multi-Protocol Label Switching) transportiert. Das sorgt für Effizienz und Ordnung.
- Segmentierung: MPLS erstellt virtuelle private Netzwerke (VPNs), um den Datenverkehr von Privatkunden, Geschäftskunden und internen Diensten sauber voneinander zu trennen.
- Quality of Service (QoS): Zeitkritische Anwendungen wie Telefonie (VoIP) oder Videostreaming können priorisiert werden, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.
WDM: Mehr Kapazität für die Glasfaser
Um die riesigen Datenmengen zu bewältigen, kommt hier oft WDM (Wavelength Division Multiplexing) zum Einsatz. Man kann es sich vorstellen, als würde man eine einzige Glasfaser in mehrere virtuelle Fasern aufteilen.
Wie funktioniert WDM?
WDM nutzt verschiedene Farben (Wellenlängen) des Lichts, um mehrere unabhängige Signale gleichzeitig über eine einzige Glasfaser zu senden. Jede Farbe ist ein eigener Datenkanal.
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
graph LR
subgraph Sender
A[Signal 1] -- Rotes Licht --> MUX;
B[Signal 2] -- Grünes Licht --> MUX;
C[Signal 3] -- Blaues Licht --> MUX;
end
subgraph Empfänger
DEMUX -- Rotes Licht --> D[Signal 1];
DEMUX -- Grünes Licht --> E[Signal 2];
DEMUX -- Blaues Licht --> F[Signal 3];
end
MUX -- Eine Faser, viele Farben --> DEMUX(De-Multiplexer);
MUX(Multiplexer)
Das Core-Netzwerk: Die Datenautobahn
Physikalisch hat Klaus den Weg ins Internet schon gefunden.
Aber woher weiß sein Router, wie er die Datenpakete an den richtigen Ort schicken soll?
Übersicht
Bestandteile des Core-Netzwerks
- Router: Leiten den Datenverkehr zwischen verschiedenen Netzwerken weiter.
- Switches: Verbinden Geräte innerhalb eines Netzwerks.
- Glasfaser: Ermöglicht schnelle Datenübertragung über weite Strecken.
BNG: Broadband Network Gateway
Klaus hat sich mit seinem Router bis zum BNG (Broadband Network Gateway) durchgearbeitet. Das ist der erste große Router im Netz des Providers.
Funktionen des BNG
- Authentifizierung: Überprüft die Zugangsdaten des Kunden (z.B. via PPPoE).
- IP-Adressvergabe: Weist dem Kunden eine öffentliche IP-Adresse zu.
- Traffic-Management: Steuert die Bandbreite und priorisiert den Datenverkehr.
Die Helfer im Hintergrund: AAA
Wenn der BNG die Zugangsdaten von Klaus empfängt, fragt er bei einem speziellen Server-System nach: dem AAA-Server (Authentication, Authorization, Accounting).
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
sequenceDiagram
Klaus-->BNG: PPPoE-Anfrage mit User/Pass
BNG-->RADIUS: Darf der rein? (Access-Request)
RADIUS-->CustomerDB: Kennst du Klaus?
CustomerDB->RADIUS: Ja, Vertrag ist aktiv.
RADIUS-->IPAM: Gib mir eine freie IP!
IPAM-->RADIUS: Hier: 100.64.123.214
RADIUS-->BNG: Ja, darf er. Hier sind die Infos. (Access-Accept)
BNG-->Klaus: Verbindung hergestellt!
Die Bausteine des Supports
- RADIUS: Das Protokoll, mit dem BNG und AAA-Server kommunizieren.
- IPAM (IP Address Management): Eine Datenbank, die alle IP-Adressen des Providers verwaltet und sicherstellt, dass jede Adresse nur einmal vergeben wird.
- CustomerDB (Kundendatenbank): Hier sind alle Vertragsdaten von Klaus gespeichert, z.B. welcher Tarif gebucht ist.
Die Zwangstrennung
In Deutschland werden Internetverbindungen oft alle 24 Stunden kurz getrennt. Dies hat historische Gründe aus der Zeit der Volumentarife, um den genauen Datenverbrauch für die Abrechnung zu erfassen.
Dieser Vorgang wird vom Provider-System, meist vom RADIUS-Server an den BNG, ausgelöst. Der BNG beendet daraufhin die Verbindung zu Klaus' Router. Der Router authentifiziert sich sofort neu, was für den Nutzer in der Regel nur eine Unterbrechung von wenigen Sekunden bedeutet.
BNG: Broadband Network Gateway
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
sequenceDiagram
Klaus-->BNG: Ich würde Gerne ins Internet!
BNG-->Klaus: Bitte gib mir deine Zugangsdaten!
Klaus-->BNG: User: Klaus, Passwort: Manta400Liebe
BNG-->Klaus: Zugang gewährt! Hier deine Infos: ✉
Erklärung:
Kunden Router bauen eine PPPoE Verbindung auf.
Der BNG Brief
Klaus hat einen Brief vom BNG bekommen. Darin steht:
IPv4-Adresse: 100.64.123.214 IPv4-Gateway: 100.64.1.1 IPv6-Adresse: 2001:db8::1234 IPv6-Gateway: 2001:db8::1 DNS-Server: 8.8.8.8 DNS-Server: 8.8.4.4
Erfinder waren optimistisch
Die Erfinder des Internets dachten, es würden nur wenige Geräte ans Netz angeschlossen werden. Deshalb haben sie IPv4 mit 32-Bit-Adressen entwickelt. Das reicht für etwa 4 Milliarden Adressen.
Doch heute sind es über 20 Milliarden Geräte! Deshalb gibt es jetzt IPv6 mit 128-Bit-Adressen. Damit können praktisch unendlich viele Geräte verbunden werden.
Die meisten Geräte nutzen heute noch IPv4, also gibt es eine Übersetzung zwischen IPv4 und IPv6.
Fast fertig
Das CGN übersetzt die private IP-Adresse von Klaus' Router in eine öffentliche IP-Adresse, damit die Daten ins Internet gelangen können.
Warum CGN?
Da es nicht genügend öffentliche IPv4-Adressen für jeden einzelnen Kunden gibt, teilt der Provider eine öffentliche IP-Adresse auf viele Kunden auf. Das CGN merkt sich, welcher Kunde welche Verbindung aufgebaut hat.
Probleme mit CGN
- Port-Knappheit: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Ports pro IP-Adresse.
- Performance: Die Übersetzung kann zu Latenz und Geschwindigkeitsproblemen führen.
- Erreichbarkeit: Dienste von außen auf dem eigenen Rechner zu hosten (z.B. ein Webserver) wird schwierig bis unmöglich.
???
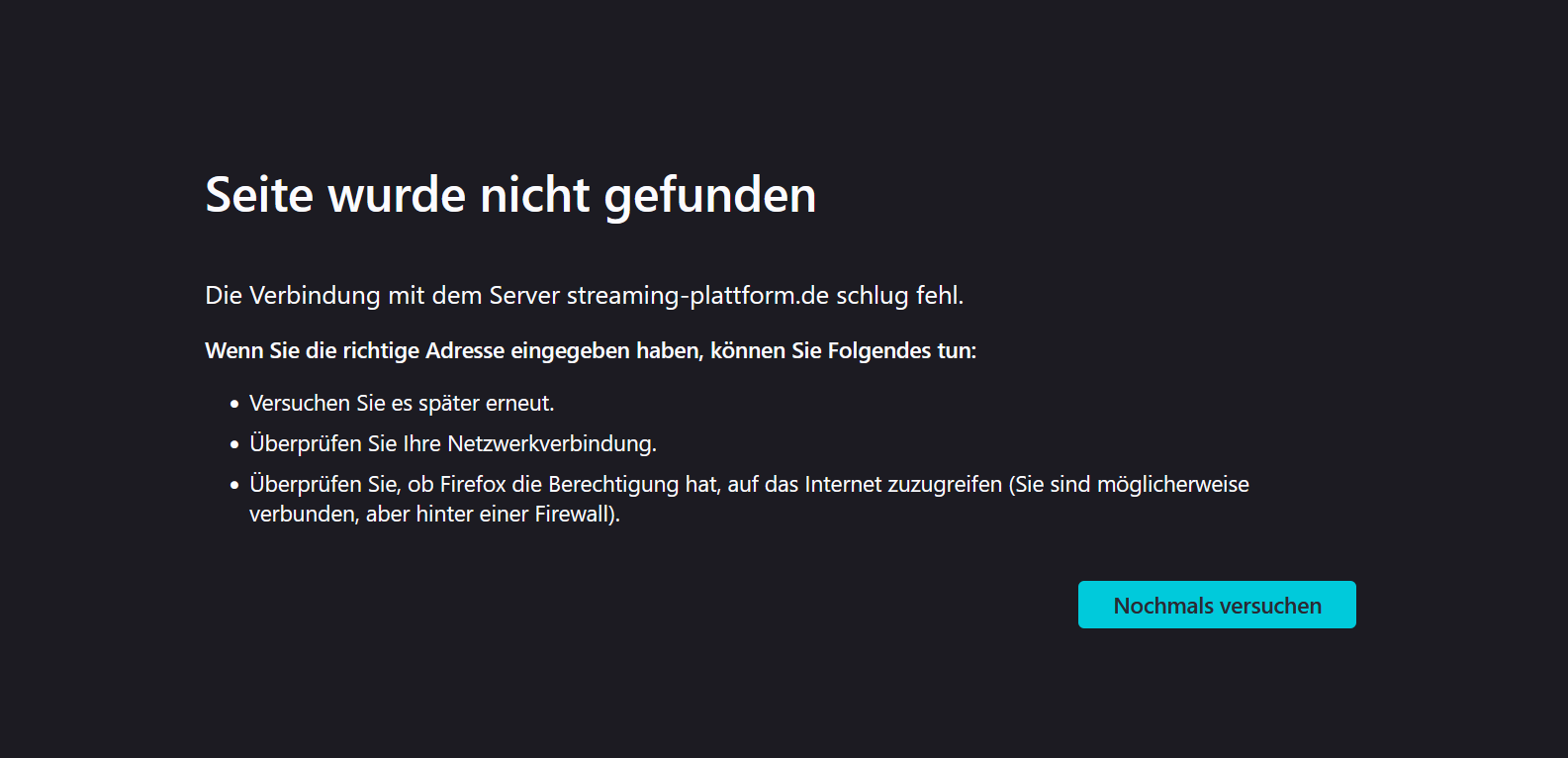
Domain Name System
Klaus fragt sich, wie sein Router die IP-Adresse vom Streaming Anbieter herausfindet, wenn er eine URL eingibt.
Das DNS (Domain Name System) ist wie ein Telefonbuch für das Internet. Es übersetzt Domainnamen in IP-Adressen.
Klaus' Router fragt den DNS-Server nach der IP-Adresse von Netflix
Domain Name System
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
sequenceDiagram
Klaus->>DNS: Was ist die IP-Adresse von Streaming-plattform.de?
DNS->>Klaus: Die IP-Adresse ist 52.31.48.193
DNS->>Klaus: Hier ist auch die IPv6-Adresse: 2600:1f18:631e:2f81::de70
Trennung von Netzen via MPLS
Stellt euch vor, das Netz eures Providers ist eine riesige Autobahn. MPLS (Multi-Protocol Label Switching) sorgt dafür, dass die Datenpakete von verschiedenen Kunden (z.B. Privatkunden, Firmenkunden) auf getrennten Spuren fahren und sich nicht in die Quere kommen.
Wie funktioniert MPLS?
Anstatt bei jedem Router die komplette Ziel-IP-Adresse zu analysieren, wird am Eingang des Provider-Netzes ein "Label" auf das Datenpaket geklebt. Die Router im MPLS-Netz schauen nur noch auf dieses Label, um das Paket blitzschnell weiterzuleiten. Das ist deutlich effizienter.
%%{init: {'theme': 'dark', 'themeVariables': { 'darkMode': true }}}%%
graph TD
A[Kunde A] --> B{Router 1};
C[Kunde B] --> B;
B -- Label 10 --> D{Router 2};
B -- Label 20 --> D;
D -- Label 10 --> E{Router 3};
D -- Label 20 --> F{Router 4};
E --> G[Ziel A];
F --> H[Ziel B];
Vorteile von MPLS
- Performance: Schnelleres Routing durch Label-Switching.
- Skalierbarkeit: Einfache Verwaltung von großen, komplexen Netzwerken.
- Quality of Service (QoS): Priorisierung von wichtigem Datenverkehr (z.B. Videokonferenzen vor E-Mails).
- Sicherheit: Trennung der Kundennetze (VPNs).
Wie BGP das Internet organisiert
Das Internet besteht aus unzähligen unabhängigen Netzwerken, den sogenannten "Autonomen Systemen" (AS). Das kann man sich wie die Länder der Welt vorstellen. BGP (Border Gateway Protocol) ist die "Sprache", mit der diese Länder (AS) untereinander kommunizieren und sich sagen, welche "Städte" (IP-Adressen) sie haben.
Autonome Systeme (AS)
Jeder größere Provider (wie die Deutsche Telekom, Vodafone oder auch die NetCom BW) betreibt sein eigenes Autonomes System. Jedes AS hat eine eindeutige Nummer (ASN).
Wenn Daten von einem AS zu einem anderen geschickt werden, regelt BGP den besten Weg.

BGP-Peering und Transit
Provider können ihre Netze auf zwei Arten verbinden:
- Peering: Zwei Provider vereinbaren, den Traffic für ihre jeweiligen Kunden kostenlos auszutauschen. Das geschieht oft an großen Internet-Knotenpunkten wie dem DE-CIX in Frankfurt.
- Transit: Ein kleinerer Provider bezahlt einen größeren Provider (einen "Tier-1-Carrier") dafür, seinen Traffic ins gesamte globale Internet zu leiten.
Wer verwaltet das alles? RIPE & ICANN
Damit im Internet kein Chaos ausbricht, braucht es Organisationen, die die Vergabe von IP-Adressen und Domainnamen koordinieren.
ICANN: Die globale Koordination
Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit für die Zuweisung von Domainnamen (wie .de, .com) und die Verwaltung des DNS-Wurzelserversystems verantwortlich ist. Sie ist sozusagen die globale "Internet-Regierung".

RIPE NCC: Die regionale Verwaltung für Europa
Die Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) ist eine von fünf regionalen Internet-Registries (RIRs). Sie ist für die Vergabe von IP-Adressblöcken (sowohl IPv4 als auch IPv6) und AS-Nummern in Europa, dem Nahen Osten und Teilen Zentralasiens zuständig.
Provider wie die NetCom BW sind Mitglied bei RIPE und erhalten von dort ihre IP-Adressen.

Takeaways
- Das Internet ist ein Zusammenspiel vieler Ebenen und Technologien.
- Vom Hausanschluss bis zum Core-Netzwerk gibt es viele Stationen.
- Technik wie MPLS, CGN und BNG sorgt für Effizienz und Sicherheit.
- IPv6 ist die Zukunft – aber IPv4 bleibt noch lange wichtig.
- Organisationen wie RIPE & ICANN halten das Netz am Laufen.